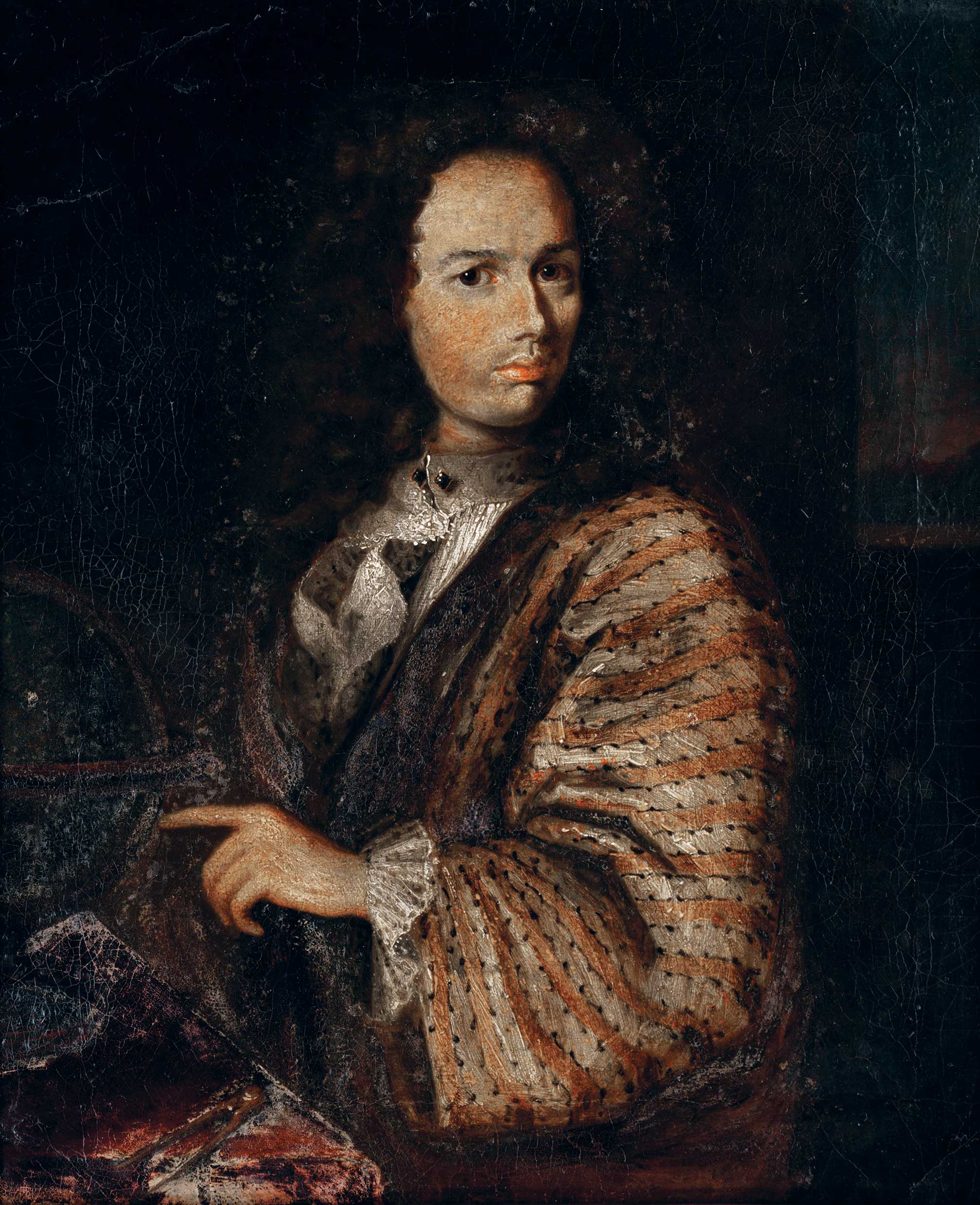Jacob Hermann (1678-1733) war der Sohn von German Hermann, damals Konrektor am Basler Gymnasium. Über seine Grossmutter väterlicherseits war er entfernt mit Leonhard Euler verwandt. 1693 begann er das Studium an der Artistenfakultät der Universität Basel, wo sein mathematischer Lehrer Jacob Bernoulli die Begabung des Studenten erkannte und ihn zu vertieften mathematischen Studien motivierte. Bei seiner Magisterprüfung im Jahr 1695 verteidigte Hermann die dritte Reihendissertation seines Mentors (Na. 001). Sein Hauptstudium der Theologie schloss Hermann 1700 mit dem Grad eines "Candidatus Sacri Ministerii" ab, der ihn berechtigte, ein Pfarramt zu übernehmen. Eine Bildungsreise führte ihn zunächst nach den Niederlanden, England und Frankreich. Dabei lernte er z.B. de Volder, Malebranche, L'Hôpital, G. D. Cassini, Reyneau, Saurin, Varignon oder De Moivre persönlich kennen. Als Ausweis seiner mathematischen Fähigkeiten diente ihm sein von Jacob Bernoulli angeregtes Büchlein "Responsio" (Na. 002), in dem er die Leibnizsche Infinitesimalmathematik gegen die Angriffe des holländischen Arztes Nieuwentijt verteidigte. Damit gewann er auch das Vertrauen von Johann I BernoulliJohann I Bernoulli (1667–1748) in Groningen, der mit Hermann seinem Partner Leibniz einen Mitstreiter im Kampf gegen die Prioritätsansprüche der Newton-Parteigänger präsentieren konnte. Nach seiner Rückkehr nach Basel wurde Hermann Assistent und Mitarbeiter seines Lehrers Jacob Bernoulli.
Nach Jacob Bernoullis Tod im Jahr 1705 verschafften ihm Leibniz und Johann I BernoulliJohann I Bernoulli (1667–1748) einen Ruf auf den Lehrstuhl für Mathematik an der Universität Padua. Dort lehrte Hermann von 1707 bis 1713 und verbreitete im Kontakt mit italienischen Mathematikern, durch Privatlektionen sowie durch zahlreiche Zeitschriftenartikel die Kenntnisse des Leibnizschen "calculus" in Italien. Hermann las über Mechanik, Hydraulik, Optik, Katoptrik, Dioptrik sowie über Gnomonik und den Gebrauch des Astrolabs und publizierte unter anderem über Probleme der beschleunigten Bewegung von Körpern im Gravitationsfeld der Erde oder über das Problem der ge¬nauen Bestimmung der Planetenbahnen. Bei letzterem gelang ihm die Lö¬sung des inversen Problems der Zentralkräfte (Na. 018). Diese Frage wurde in jener Zeit ausserordentlich kontrovers diskutiert, insbesondere nachdem Johann BernoulliJohann I Bernoulli (1667–1748) behauptet hatte, Newtons Lösungen des Problems in dessen Principia seien unvollständig, während er selbst über die voll¬ständige Lösung des Problems verfüge. Da Hermann daran festhielt, dass er seine eigene Lösung un-abhängig vom Meister in Basel gefunden hätte, erregte dies den Zorn seines Gönners. Johann BernoulliJohann I Bernoulli (1667–1748) wird von da an nicht müde, Hermanns Lösung des inversen Problems als ebenso unvollständig wie die Newtons zu kritisieren, was das Verhältnis zu seinem ehemaligen Schützling auf Dauer trüben sollte.
Da Hermann sich als Protestant im katholischen Milieu Paduas nicht wohlfühlte, nahm er 1713 einen durch Leibniz vermittelten Ruf an die preussische Universität in Frankfurt/Oder an. Dort vollendete er auch sein noch in Padua begonnenes Hauptwerk, die Phoronomia (Na. 022) , das 1716 erschien. Leider präsentierte er in diesem Lehrbuch der theoretischen Mechanik seine mit Leibnizschen Methoden gewonnenen Resultate in der alten Form der euklidischen, d.h. geometrischen Beweisführung anhand von Figuren, was das Studium des Buches eher erschwerte. Immerhin findet sich darin z.B. auch eine der ersten Formulierungen des Newtonschen Kraftgesetzes in differentieller Form. Auch enthält Hermanns Buch einen ersten Ansatz zu einer kinetischen Theorie der Wärme, wie er erst später bei Euler oder Daniel BernoulliDaniel I Bernoulli (1700–1782) zu finden ist. Zahlreiche Aufsätze aus Hermanns Feder sind zudem in der lokalen Zeitschrift Exercitationes subcessivae Francofurtenses enthalten.
Eine neue Kontroverse mit Johann I BernoulliJohann I Bernoulli (1667–1748) brach aus, als Hermann 1718 seine Lösung einer von Johann I BernoulliJohann I Bernoulli (1667–1748) gestellten isoperimetrischen Aufgabe in einem eigenen Beitrag (Na. 024) unmittelbar nach Johann BernoulliJohann I Bernoulli (1667–1748) erstem Teil von dessen Aufsatz zum gleichen Problem (Op. CIII) in den Acta Eruditorum publizierte. Johann BernoulliJohann I Bernoulli (1667–1748) sah dadurch wieder einmal seinen Prioritätsanspruch auf eine seiner Entdeckungen bedroht. Als Hermann noch dazu behauptete, dass er seine Lösung bereits 1712 in Italien gefunden habe, und überdies die Arbeiten von Jacob Bernoulli zum gleichen Problemkreis pries, motivierte der streitbare Johann I BernoulliJohann I Bernoulli (1667–1748) 1720 seinen Sohn Nicolaus IINicolaus II Bernoulli (1695–1726) zu einem langen polemischen Aufsatz (Op. 116). In seiner Reaktion von 1722 auf diesen Aufsatz (Na. 036) bezeichnete Hermann unter anderem dessen jungen Autor herablassend als den "Herrn Lizentiaten" wohl wissend, dass die wichtigsten Partien des Textes aus der Feder des Vaters von Nicolaus IINicolaus II Bernoulli (1695–1726) stammten. Dies beendete dann endgültig das Vertrauensverhältnis zwischen Hermann und seinem einstigen Mentor. Trotz einiger Versöhnungsversuche Hermanns konnte es bis zu seinem Tod nicht wieder hergestellt werden.
1725 wechselte Hermann von Frankfurt/Oder auf die finanziell hochdotierte Stelle eines Professors Primarius für die höhere Mathematik an der Petersburger Akademie. Dort fühlte er sich zunächst im Kreis seiner Basler Kollegen Nicolaus IINicolaus II Bernoulli (1695–1726), Daniel BernoulliDaniel I Bernoulli (1700–1782) und Leonhard Euler wohl. Doch brach im Lauf der Zeit bald ein wissenschaftlicher Kleinkrieg zwischen der Bernoulli-Partei und Hermann aus. 1728 wurde der kaiserliche Hof von Petersburg nach Moskau verlegt, was die Bedingungen an der Akademie verschlechterte, so dass Hermann auf eine Rückkehr nach Basel trachtete. Doch musste er noch bis 1730 ausharren, da er im Auftrag der russischen Kaiserin Anna ein Lehrbuch für den jungen Zarewitsch Peter II., den Abregé des Mathematiques (Na. 050 und Na. 051) , zu verfassen hatte. 1731 reiste Hermann nach Basel zurück, wo er den Lehrstuhl für Ethik übernahm und über Philosophia Moralis et Jus Naturale las. In Basel entstanden noch vier Abhandlungen für die Petersburger Akademie. Doch erkrankte Hermann im Sommer 1733 schwer und verstarb am 11. Juni dieses Jahres in seiner Geburtsstadt.
Im Unterschied zu seinen Mentoren Jacob und Johann I BernoulliJohann I Bernoulli (1667–1748) war es Jacob Hermann nicht vergönnt, seine zahlreichen Zeitschriften-Aufsätze zu sammeln und in einer Opera omnia-Ausgabe zu publizieren. Der handschriftliche Nachlass des Junggesellen gelangte in die Hände seines Bruders German und ist zum Teil zerstreut worden, zum Teil verloren gegangen. Von Hermanns Briefwechsel sind immerhin ca. 560 Briefe mit 38 Korrespondenten (darunter Gottfried Wilhelm Leibniz, Johann IJohann I Bernoulli (1667–1748) und Nicolaus I BernoulliNicolaus I Bernoulli (1687–1759), Leonhard Euler, Louis Bourguet, Sebastiano Checozzi, Christian Goldbach, Guido Grandi, Giovanni Poleni, Pierre Varignon und den Brüdern Scheuchzer) erhalten.
(Fritz Nagel)